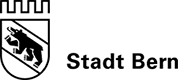Literarische Auszeichnungen 2025
Michael Stauffer, Andri Beyeler und Sarah Elena Müller werden mit dem Stipendium Weiterschreiben ausgezeichnet.
Die Preisverleihung fand am Mittwoch, 5. November 2025 im Sous Soul in Bern statt.
Laudatio auf Michael Stauffer
Michael Stauffer ist der erste Preisträger der diesjährigen Weiterschreiben-Stipendien. Er wurde 1972 in Winterthur geboren und lebt in Biel. Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und des Fachs Bildnerisches Gestalten in Bern arbeitet er seit 1999 als freier Schriftsteller, Musiker und Performancekünstler.
2001 erscheint sein erstes, von der Kritik einhellig gelobtes Prosawerk «I promise when the sun comes up, I promise I’ll be true». Seither folgten – fast im Jahrestakt – über zwanzig weitere Titel, zuletzt «Glückspilzbank», 2023, und «Wühl!», 2025. Darüber hinaus veröffentlicht Stauffer Theaterstücke und Hörspiele sowie, gemäss eigener Terminologie, «sonstige Kunst».
Sein Oeuvre ist beeindruckend – die Vielfalt ist es und vor allem auch die Kadenz, in welcher seine Werke erscheinen. Sie könnten glatt die Auslage eines Buchhandlungs-Schaufensters füllen.
Stauffer wurde schon als «der Chili im Arsch der Schweizer Spoken-Word-Szene» gehandelt (Pablo Haller, Ausgabe 31, Dezember 2017; zuletzt abgerufen am 19.10.2025) und bezeichnete sich selbst als «AOWA – ausserordentlicher Wirtschaftsexperte auf Abruf» (Ausgabe 20, April 2015; zuletzt abgerufen am 19.10.2025), um nachzuschicken, er habe schon immer eine Bank besitzen wollen; bei ihm könnte man nur einzahlen und nichts mehr abheben. Und man könnte sein Geld am Samstag besuchen kommen, allerdings natürlich nur gegen eine Besichtigungsgebühr.
Legen wir also den Brennpunkt unserer literarischen Lupe auf diesen einen Aspekt seines Schaffens. Stauffer hat sich nämlich nicht erst bei der Arbeit zum jüngsten Roman «Glückspilzbank» mit dem Bankenwesen, dem Finanzsektor und mit der oftmals an Esoterik erinnernden Mechanik der Börse befasst. Schon 2010 erschien ein Hörtext mit dem Titel «Die Frau mit der Bankenkrise», 2016 das SRF-Feature «Oligarchenlehrling» oder 2019 das Hörspiel «Die dritte Arbeitskraft, mein Geld», das im gleichen Jahr den Publikumspreis der ARD-Hörspieltage gewann.
Der Roman nimmt Schwung auf, als Mikka und ihr Freund Andreas nach einem an Insiderhandel anmutenden Deal satte 16 Millionen einfahren und hierauf beschliessen, die Onnepekka Pankki, die Glückspilzbank, zu gründen. Deren Zielsetzung, das «kreative Schrumpfen der Geldwirtschaft», ist in das luftige – ja gar windige – Gewand einer Shareholder-Value-Heilslehre gekleidet, die derart überdreht ist, dass der maximale Gewinn in der Auflösung gesucht wird: Nicht nur in der Auflösung aller Geldwerte, sondern auch in der Auflösung der vermögenden Person an sich, die bei der Bank investiert.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieser Ansatz so überdreht nicht ist. Liest man nämlich parallel zu «Glückspilzbank» bestimmte Kapitel des Berichts der parlamentarischen Untersuchungskommission über die «Geschäftsführung der Behörden (im Zusammenhang mit der) CS-Notfusion», muss man feststellen, dass der Roman nicht die Wirklichkeit als Groteske beschreibt, wie das im Klappentext angekündigt wird. Vielmehr entpuppt sich die surreal anmutende Parodie als realitätsnahe Dokufiktion. Doch das ist nicht etwa eine literarische Fehlleistung; vielmehr ist das ein Indiz dafür, wie grotesk die Finanzwelt-Wirklichkeit sein kann. Insofern könnte man dem Text kathartische Wirkung zuschreiben, da er vor Augen führt, wovor die Augen nicht verschlossen werden sollten.
Auf die Frage, wie er, der zu den wenigen Autoren gehöre, die sich der Wirtschaft annehmen, sich die Scheu der Literatur vor dem Finanzsektor erkläre, antwortete Michael Stauffer: «Man kann damit weniger gut Preise gewinnen als mit einem Thema, das in aller Munde ist.»
Nun ja, dumm gelaufen... Auch damit lässt sich Preise gewinnen. Gerne überweisen wir das Preisgeld auf das Konto einer Bank Ihrer Wahl – bei Gelegenheit werden wir im nächsten Jahr eines Samstags vorbeischauen, um es zu besuchen. Und wir hoffen, dass sich das Geld in Buchstaben, Sätze und Kapitel verwandelt haben wird und die Besichtigungsgebühr darin besteht, dannzumal ein neues Werk, das sicherlich bereits in Arbeit ist, schon gelesen zu haben.
Michael Stauffer, im Namen der Weiterschreiben-Jury und der Kulturkommission der Stadt Bern gratuliere ich herzlich!
Laudatio auf Andri Beyeler
«Und Texte müssen wahrhaft sein. Diesen Anspruch habe ich. Und Wahrheit ist nicht absolut, sondern immer vielschichtig. Und gut tönen sollte es auch noch.»
Diese Aussagen stammen aus einem Gespräch mit Endo Anaconda. Sie treffen auch auf die Texte des Preisträgers zu.
Andri Beyeler schreibt seit vielen Jahren Theatertexte für die Bühne. Aus den Stoffen dieser Texte entstehen seine Bücher. Sie heissen «Sang von einem Drucker und Siedler» und «Mondscheiner», beide im Verlag «Der gesunde Menschenversand» erschienen. Und er zeichnet.
Das Fundament seiner vielschichtigen künstlerischen Arbeit ist bei allem die Dramatik.
Bei Recherchen für ein Tanztheaterprojekt zum Thema «Aussenseiter» ist er vor längerer Zeit auf Fritz Jordi gestossen, einen in Bern 1885 geborenen Kommunisten, Drucker und Nonkonformisten, der mit 53 Jahren in Ronco oberhalb von Ascona in der Fontana Martina, einer Künstler*innen Kolonie, die er gegründet hat, verarmt gestorben ist.
Die Faszination für das durch den Sozialismus geformte Leben von Fritz Jordi hat Andri Beyeler immer tiefer eintauchen lassen in archivierte Tagebucheinträge, Zeitschriften, Zeitungen, Auszügen aus Gerichtsverhandlungen und Polizeiberichten. Daraus ist «Sang von einem Drucker und Siedler» entstanden, eine Biographie, die das Leben dieses «Schpinnsiechs» in Schaffhauser Dialekt, Andri Beyelers Muttersprache, und Deutsch in balladesker Weise gleich mehrstimmig nachsingt. Ein Text, den er mit rot-schwarzen Zeichnungen im Stil historischer Holzschnitte sekundiert und poetisch illustriert hat.
Fritz Jordi versuchte immer wieder aufs Neue alle seine Kräfte für eine bessere Gesellschaft zu mobilisieren und unermüdlich und mit viel Schaffenskraft andere für seine Vorstellungen zu gewinnen und seine Ideen in Büchern und Monatsblättern weiterzugeben – und zwar, vom Staat wegen seiner Gesinnung überwacht, bis zum Tod.
Das Ganze ist beeindruckend gut gemacht und deckt Seiten eines Daseins auf, das bis nach Russland, Deutschland, Italien Spuren in Beziehungen und Werken der Kunst von Gleichgesinnten und Nachfahren hinterlassen hat, und heute noch hochaktuell ist: Der «Schpinnsiech» hatte Träume. Mit der Fontana Martina wollte er eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ins Leben rufen, die eine Druckerei, eine Weberei, eine Töpferei und eine Beiz betreibt. Hier sollte in Selbstversorgung mit Tieren gelebt und im Glauben des Sozialismus für eine bessere Gesellschaft gearbeitet werden.
Alles, was das künstlerische Werk von Andri Beyeler ausmacht, ist darin vereint: Vielstimmigkeit, Rhythmus, Sprachgesang, Poesie und Humor. Die Werkzeuge sind: sein Schaffhauser Dialekt, die Durchdringung des Stoffes durch Auseinandersetzung mit den Fakten aus Archiven, die Erforschung seines Könnens durch den Stoff, die Verortung des Werks in der Geschichte der Schweiz und die Kraft der Bildsprache, die kongruent zum Text passt.
Das ist wahrhaft, das ist vielschichtig und tönt gut, um die eingangs zitierten Worte von Endo Anaconda aufzugreifen.
Laudatio auf Sarah Elena Müller
Wir sind nicht die Ersten, die Sarah Elena Müllers Werk auszeichnen, und wir werden nicht die Letzten sein. Aber wir wollen unbedingt, dass sie weiterschreibt.
Denn: Erstaunliches fördert sie zutage. Mit einem scharfen Gespür und einer unerbittlichen Genauigkeit bedient sie sich der Sprache, um Gewaltiges freizulegen. Sie entblösst Umstände, Zustände, Situationen und Beziehungen – und verliert dabei nie ihre Zugehörigkeit und Menschlichkeit aus den Augen. Subtil, ohne einseitige Zuweisungen, aber mit unbestechlicher Schärfe analysiert und beobachtet sie.
Manchmal ist das Lesen ihrer Texte zähflüssig, intensiv. Denn du wirst beim Lesen involviert – und so erwischt es dich oft unvorbereitet. Immer mehr entlarvt sich ein Kern, der zutiefst verstörend ist, oder Beobachtungen, die ins Schwarze treffen. Umso stärker kann dich ihr Werk berühren: Die Botschaft kommt durch und wirkt nach.
Doch immer ist auch ihr Sarkasmus und Witz zu spüren. Eine anfallende Situationskomik, ein Galgenhumor, der uns heute – angesichts der Weltlage – guttut.
Sie macht, was sie will: lässt Gegenstände sprechen, versetzt sich in Stofffetzen, dialogisiert mit Pflanzen. Manchmal stringent, manchmal sprunghaft. Sie unterwirft sich keiner Erzählform ausser ihrer eigenen. Und doch weiss sie genau, worauf sie hinauswill. Das macht Sarah Elena Müllers Schreiben so eigenwillig – und so besonders. Wir sind gespannt, was noch kommt!
Ihr Mut, Bilder zu nutzen, Parabeln zu entwerfen, um Dingen auf den Grund zu gehen, öffnet Räume und Denkebenen – und diese geben den Lesenden die Freiheit, eigene Räume zu erschliessen, zu interpretieren.
Sie hat sich doch schon auf so vielen Sparten ausprobiert: Als Künstlerin, Autorin und Musikerin. Die Vielfalt ihrer Projekte bringt Unterschiedlichstes hervor: Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiele und Performances. Sie wird sich immer wieder neu erfinden müssen – und sie wird sich nichts schenken. Darum braucht sie Zeit, um ihren vielen Aufgaben nachzugehen.
In ihren eigenen Worten aus dem Buch «Cultrestress» im Kapitel «Die fein Art», in welchem es um die Frage geht, wie du als Bildende Künstlerin überleben kannst:
«Chame die Ziit, wo me im Atelier ad Wand het gstarrt, au verrechne?
Oder di schlaflose Nächt vo de Konzeption?
Und wie viel söll me für es knickts Ego budgetiere?»
Erst 35 Jahre alt, hat sie bereits Eindrückliches vorzuweisen: Am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb hat sie uns stolz gemacht, den kantonalen Literaturpreis der Stadt Bern hat sie neben vielen anderen Preisen und Stipendien auch bereits erhalten. Sie hat drei Bücher veröffentlicht, zwei Alben und engagiert sich in der Literaturszene als Netzwerkerin: Sie ist eine der Mitbegründerinnen des feministischen Autorinnenkollektivs RAUF. Ausserdem ist sie Teil der Zürcher Literaturkommission und hilft selber mit, Subventionsgelder sinnvoll einzusetzen.
Und doch, auch im selben, eben zitierten Text analysiert sie, wie viel – beziehungsweise wenig – ein Preis effektiv hilft, am Beispiel der Bildenden Kunst:
«Ja, stimmt, isch ja nöd so, dass en Swiss Art Award (oder es witerschrib Stipendium) würklich e nachhaltigi Inveschtition id Kunschtproduktion vo dene erfolgriiche vier Prozent wär.
Vier Jahr Hype, vier Jahr lang kei AHV oder BVG iizahlt, vier Jahr Sozialamt, acht Prozent Kürzige, acht Jahr Existenzängscht und Depressione, sechzäh Jahr im Zwiespalt mit de Kunscht an sich, zweiedrissg Jahr ortsbezogeni Gsuech um Kultursubventione, foifesechzg Jahr föderalistischi Förderigsstrukture, es Läbe lang rektali Beschmeichelig vo wichtige Funktionäre – und immer no klischiert brotlos.
Und ohni pragmatischi Fähigkeite geischteret: das Fantom der Kantone!
Hantone? Du meinsch, wil mer erscht nach zwei Jahr und nur a sim stüürrechtliche Wohnsitz Finanzierigsaarecht het? (amüsiert) Als ob du überhaupt Stüüre würsch zahle.»
Und trotzdem glauben wir, wirst Du den Preis gut einsetzen können. , liebe Sara Elena Müller, wir gratulieren Dir im Namen der Jury und der Kultur Stadt Bern zum Weiterschreib-stipendium 2025!