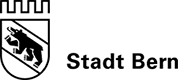Inhalte
Die künftigen Zweckkategorien für die Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) sind breit gefasst: Sie gewährleisten, dass die heutigen Nutzungen weiterhin möglich sind. Gleichzeitig kann die Stadt Bern flexibel auf neue Nutzungsbedürfnisse reagieren. Zudem es gibt künftig Spielräume bei der Maximalhöhe der Gebäude.
Heute gibt es in Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) viele Nutzungskombinationen, etwa Jugendtreffs mit Schulen und Kirchen. Deshalb legt die Revision sieben relativ allgemein gehaltene Zweckkategorien fest. Zusammen mit der Möglichkeit, einem Areal mehreren Kategorien zuzuweisen, gewährleistet dies die heutigen Nutzungen und sichert gleichzeitig die nötige Flexibilität für Umnutzungen.
Laut kantonaler Vorgabe ist für jedes Areal die Maximalhöhe festzulegen, auch wenn heute kein konkretes Bauprojekt vorliegt. Die Revision legt diese Maximalhöhen fest und ermöglicht es, sie unter bestimmten Voraussetzungen um bis zu einem Drittel zu überschreiten. So lassen sich gewisse Spielräume für spätere Bauprojekte wahren.
Welche Nutzungen umfassen die sieben Zweckkategorien?
Die sieben Kategorien umfassen jeweils mehrere Nutzungen:
- Die Kategorie «Bildung, inklusive schulbetriebliche Aussenräume/Sportanlagen und soziale Angebote im öffentlichen Interesse» (B) beinhaltet z. B. Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen mit Pausenplatz und Fachhochschulen.
- Die Kategorie «Freiräume mit zugehöriger Infrastruktur (ZöN)/Freiräume, inklusive zudienende Nutzungen (ZaI)» (F) beinhaltet z. B. Parks- und Grünanlagen, Spielplätze, Freibäder und Rasensportfelder.
- Die Kategorie «Gesundheit und Pflege» (G) beinhaltet z. B. Spitäler, Kliniken, Alters- und Pflegeheime, Wohnheime und gesundheitsbezogene Dienstleistungen.
- Die Kategorie «Infrastruktur» (I) beinhaltet z. B. Carparkplätze, Fernbus- bzw. Carterminals, Tram- und Busdepots, grössere Werk- oder Entsorgungshöfe und Elektrizitätswerke.
- Die Kategorie «Kultur, Religion und soziale Angebote im öffentlichen Interesse» (K) beinhaltet z. B. Konzertlokale, Theater, Museen, Bibliotheken, Archive, Jugendhäuser und Kirchen.
- Die Kategorie «Sport- und Freizeitanlagen» (S) beinhaltet z. B. Turnhallen, Freibäder und Sportfelder (inkl. Kunstrasen).
- Die Kategorie «Verwaltung» (V) beinhaltet z. B. Verwaltungsgebäude, Gerichte und Asylunterkünfte.
- Zudem gibt es eine Reihe von Arealen mit besonderen Nutzungsbestimmungen ausserhalb der Zweckkategorien (z. B. Schützenmatte).
Weshalb gibt es Standardfestlegungen für Freiräume und Sportflächen?
Ob Pärke, Plätze oder Sportflächen: Die Zweckbestimmung und Grundzüge der Überbauung und Gestaltung sind für die meisten Freiräume und Sportflächen gleich. Deshalb werden diese Zonen grossmehrheitlich mit Standardfestlegungen geregelt. Bedeutende Freiräume sind künftig hauptsächlich über die Standardfestlegungen «grüner Freiraum», «grüner Freiraum mit Bebauung» und «urbaner Freiraum» geschützt. Diese sichern und fördern innerstädtische Freiraumqualitäten und machen die urbanen Räume widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. Freiräume für Sport und Freizeit werden mit der Standardfestlegung «Freiraum für Sport und Freizeit» geregelt.
Wie hoch dürfen Bauten und Anlagen maximal sein?
Massgebend ist, welche Höhe in den einzelnen Arealen städtebaulich verträglich ist. Für das erste Vollgeschoss gilt eine Fassadenhöhe von 5 Metern. Für die oberen Geschosse werden die Fassadenhöhen in Schritten von jeweils 4 Metern festgelegt. Diese Geschosshöhe ist z. B. bei Schulhäusern und Spitälern häufig nötig, um genügend hohe und lichte Räume zu schaffen.
Maximal 30 Meter hoch
Somit ergeben sich folgende maximalen Fassadenhöhen: 5.00 Meter, 9.00 Meter, 13.00 Meter, 17.00 Meter, 21.00 Meter, 25.00 Meter oder Gesamthöhe max. 30.00 Meter. Es gibt aber Ausnahmen: Bei Familiengärten beträgt die maximale Fassadenhöhe 3 Meter, weil hier höhere Gebäude nicht erwünscht sind. Auch in urbanen Freiräumen sind nur kleine Bauten erlaubt, z. B. WC-Anlagen oder ein Kiosk; hier beträgt die Maximalhöhe 4 Meter.
Speziallösungen für bestimmte Orte
In wenigen Fällen sind ortsspezifische Fassadenhöhen geplant, z. B. bei der Pestalozzi-Schule. Gleiches gilt für einzelne Areale mit bestehenden Hochhäusern, z. B. im Viererfeld mit Burgerspittel. Ausserdem wird auf einzelnen Arealen die Möglichkeit geschaffen, ein Hochhaus mit öffentlichen Nutzungen zu erstellen, z. B. beim heutigen Entsorgungshof Fellerstrasse in Bümpliz.
Wann ist eine Mehrhöhe zulässig?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es erlaubt, die festgelegte Maximalhöhe um maximal einen Drittel zu überschreiten. Dafür müssen die untenstehenden Voraussetzungen erfüllt sein. Die Regelung ermöglicht, dass sich geeignete Areale mit verhältnismässigem Aufwand weiterentwickeln lassen.
Qualitätssicherndes Verfahren nötig
Für diese Bauprojekte ist in einem qualitätssichernden Verfahren nach SIA-Vorgaben aufzuzeigen, dass die gewünschte Höhe städtebaulich verträglich ist. In der Jury ist die Stadt Bern in Absprache mit dem Stadtplanungsamt mit mindestens einer Fachperson vertreten. Die maximale Gesamthöhe von 30 Metern bleibt oberstes Limit. Die Zusatzhöhe ermöglicht überhohe Räume oder ein zusätzliches Geschoss. Sie kann auch dazu dienen, technisch bedingte oder dem Terrain geschuldete Erhöhungen aufzufangen.
Spielräume wahren
Die Möglichkeit der Mehrhöhe gleicht die starre Regelung der Maximalhöhe aus: Diese muss gemäss kantonaler Vorgabe für jedes ZöN-Areal festgelegt werden, auch wenn heute kein konkretes Bauvorhaben vorliegt. Dank der in bestimmten Fällen möglichen Mehrhöhe bleiben gewisse Spielräume gewahrt. So muss nicht bei jedem Ausbauvorhaben erneut ein Planerlassverfahren durchgeführt werden.
Warum wird die Geschossflächenziffer abgeschafft?
Auf den meisten Arealen wird die oberirdische Geschossflächenziffer abgeschafft, die bisher die Bebaubarkeit begrenzte. Neu werden dafür Maximalhöhen und die Grünflächenziffer eingeführt. Mit der Möglichkeit, die Maximalhöhe um bis zu einem Drittel zu überschreiten, bleibt zudem die nötige Flexibilität gewahrt, um geeignete Areale baulich weiterzuentwickeln.
Bei einigen Arealen ist das Maximum an möglicher Geschossfläche heute schon ausgeschöpft. Bei wenig bebauten ZöN-Arealen, wie z. B. Parkanlagen, bleibt die Bebauung auch künftig stark eingeschränkt; hier regelt weiterhin die Geschossflächenziffer das Mass der zulässigen baulichen Nutzung.
Wie funktioniert die Grünflächenziffer?
Die Grünflächenziffer sichert begrünte Bodenoberflächen. Ihre Bemessung orientiert sich in den allermeisten ZöN-Arealen am Bestand sowie an vorliegenden Bauprojekten. Bei stark versiegelten Arealen soll sie die Entsiegelung fördern. Bei Arealen, die bereits heute fast vollständig überbaut sind, wird auf eine Grünflächenziffer verzichtet.
Das lässt sich anrechnen
Die Grünflächenziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur gesamten Grundstücksfläche. Als anrechenbare Grünfläche gelten natürliche und/oder bepflanzte Bodenflächen, die nicht versiegelt sind und nicht als Abstellfläche dienen: Rasen- und Wiesenflächen, offene Pflanzflächen von Stauden, Gräsern und Gehölzen sowie natürlicher Fels. Rasenwabenbelag, Schotterrasen sind die wenigen Belagsflächen, die ebenfalls angerechnet werden können.
Mergel, Kies usw. gehören nicht dazu
Nicht als Grünfläche anrechnen lassen sich:
- Mergel, Kies, Schotter, Rasengitterpflaster wegen ihres niedrigen Begrünungspotenzials;
- Dachbegrünungen und Ruderalflächen aufgrund des Fehlens einer belebten Humusschicht;
- Flächen über unterirdischen Bauten.
Was ist eine ZaI? Und wie ist die Enteignungsfrage geregelt?
In Zonen für öffentliche Nutzungen besteht gemäss übergeordnetem Recht ein Enteignungsrecht für den vorgesehenen Zweck (Bildung, Gesundheit, Infrastruktur etc.). Einige Grundeigentümerschaften hatten bereits in der Vergangenheit starke Vorbehalte gegen dieses Enteignungsrecht. Das führte zum Stadtberner Sonderfall der Unterteilung der ZöN in F (mit Enteignungsrecht) und F* (ohne Enteignungsrecht).
Die neue ZöN-Systematik unterscheidet wie bisher zwischen Zonen mit und ohne Enteignungsrecht. Letztere werden neu als Zonen für Nutzungen im allgemeinen Interesse (ZaI) bezeichnet. Nicht enteignet werden können insbesondere Privatschulen, Spitäler, Heime, Sportanlagen und einige Grünräume, die mehrheitlich im Besitz der jeweiligen Eigentümerschaften sind.
Weshalb soll künftig der Stadtrat Änderungen an ZöN beschliessen können?
Für jede ZöN sind die Zweckbestimmungen und die Grundzüge der Überbauung und Gestaltung im Anhang der Bauordnung festgelegt. Eine Änderung der Bauordnung muss heute der Stimmbevölkerung vorgelegt werden. Das kantonale Recht sieht aber die Möglichkeit vor, die Kompetenz zu Änderungen der Bauordnung an das Parlament (Stadtrat) zu delegieren.
Delegation an den Stadtrat
Um der Dynamik in der Stadtentwicklung gerecht zu werden und öffentliche Aufgaben möglichst effizient zu erfüllen, soll neu das Parlament (Stadtrat) Änderungen der ortsspezifischen Festlegungen von ZöN im Anhang der Bauordnung beschliessen können, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.
Demokratische Rechte bleiben gewahrt
Dies dient der Beschleunigung der Planerlassverfahren, der Effizienz in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und vermeidet unnötige Kosten. Die demokratischen Rechte der Bevölkerung bleiben über die Repräsentation durch das Parlament sowie die Möglichkeit der Ergreifung des fakultativen Referendums dabei gewahrt.