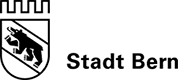Ziele der Revision
Ob Schule, Sportanlage oder Werkhof: Dank der Revision der Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) fallen bei Bauvorhaben in den meisten Arealen aufwändige Planungsverfahren weg. Auch sollen geeignete Areale baulich besser genutzt werden können.
Heute muss die Stadt Bern für fast jedes Bauvorhaben in Zonen für öffentliche Nutzungen (ZöN) vorgängig die Planungsgrundlagen anpassen. Diese separaten Planänderungsverfahren verzögern Bauprojekte meist um Jahre und verursachen unverhältnismässige Kosten. Dank der ZöN-Revision und ihrer neuen Systematik schafft die Stadt eine rechtskonforme Grundlage, womit künftig bei Bauvorhaben auf den meisten Arealen solche Einzelverfahren nicht mehr nötig sein werden.
Die neuen Bestimmungen schützen Grünräume, pflegen das Ortsbild und sichern damit städtebauliche Qualitäten. An geeigneten Standorten schaffen sie Möglichkeiten, die öffentliche Infrastruktur weiterzuentwickeln. Der Ausbau muss in Einklang mit dem Ortsbild- und Denkmalschutz erfolgen und den Anforderungen an öffentliche Freiräume und an das Stadtklima genügen.
Bei vielen Arealen führt die Revision zu keinen oder nur geringen materiellen Änderungen, weil die Entwicklungsreserven bereits ausgeschöpft sind, die bestehenden Nutzungen erhalten werden sollen oder andere raumplanerische Interessen wie etwa der Schutz des Grünraums oder des Ortsbildes Vorrang haben. Trotzdem müssen alle diese Areale in die neue Systematik überführt werden.
Was war der Auslöser der Revision?
Heute braucht es für die Bewilligung und Ausführung der meisten Bauvorhaben in ZöN-Arealen ein Planänderungsverfahren. Das ist die Folge von zwei kantonalen Gerichtsurteilen.
Kanton stoppt zwei Projekte
Im Urteil von 2011 ging es um das Tierheim in Oberbottigen: Der Berner Tierschutz wollte das alte Gebäude durch ein neues ersetzen, wofür eine neue Erschliessung nötig war. Der Gemeinderat erlaubte sie mittels geringfügiger Änderung des Zonenplans. Aufgrund von Einsprachen kam es zu einem Verwaltungsgerichtsurteil: Die Stadt Bern müsse für die entsprechende Zone zuerst die Zweckbestimmung und die Grundzüge der Überbauung und Gestaltung festlegen, was ein ordentliches und damit aufwändigeres Verfahren zur Folge gehabt hätte. Das zweite Urteil von 2015 betraf die Umnutzung eines alten Garderobengebäudes auf dem Sportplatz Weissenstein und lautete ähnlich.
Praxis wird nicht mehr akzeptiert
Das kantonale Baugesetz schreibt seit 1985 vor, dass für jede ZöN die Zweckbestimmung – also die zulässigen Nutzungen – und die Grundzüge der Überbauung und Gestaltung (z. B. Mass der Nutzung, Maximalhöhen, Grünflächenanteil, Vorschrift zu qualitätssichernden Verfahren) festzulegen sind. Die Stadt hielt an ihrer bewusst offenen Festlegung der ZöN fest, um bei der Weiterentwicklung flexibel zu sein. Der Kanton akzeptierte die Praxis bis zu den zwei Gerichtsentscheiden. Seither hat die Stadt über ein Dutzend Planänderungsverfahren durchgeführt, wie etwa für die Sanierung und Erweiterung von Schulhäusern (z.B. Areal Goumoëns/Volksschule Weissenbühl).
Worin besteht der Nutzen der Revision?
Mit der Revision schafft die Stadt Bern eine rechtskonforme Regelung, womit bei Bauvorhaben in den meisten ZöN-Arealen separate Planänderungsverfahren wegfallen.
Zeitgewinn von mehreren Jahren
Ein solches Planänderungsverfahren dauert oft mehrere Jahre, nicht selten fünf bis sieben. Im Fall von Einsprachen und komplexen Bauvorhaben kann es noch länger dauern. Die Kosten belaufen sich in der Regel auf 100'000 bis 300'000 Franken.
Rund 20 Areale profitieren direkt
Aktuell sind für rund 20 ZöN-Areale Entwicklungsabsichten bekannt, für die ohne Revision Einzelverfahren nötig wären. Die Revision wird voraussichtlich 2028 öffentlich aufgelegt und hat ab diesem Zeitpunkt rechtliche Vorwirkung. Ziel ist die Inkraftsetzung per 2030. Danach erübrigen sich für die meisten ZöN-Areale in den nächsten 10 bis 15 Jahren die bisher regelmässig notwendigen Planerlassverfahren.
Punktuell Entwicklung ermöglichen
Dort, wo städtebaulich verträglich und sinnvoll, lassen sich mit der Revision in bestehenden ZöN bauliche Entwicklungspotenziale nutzen und gleichzeitig die Frei- und Grünräume erhalten. Die Grundeigentümerschaften erhalten Rechtssicherheit für die Weiterentwicklung der Areale. Zugleich wissen die Nachbarschaften künftig, wie hoch und dicht gebaut werden darf.
Entstehen zusätzliche Flächen für öffentliche Nutzungen?
Die Revision sichert die bestehenden Flächen und schafft die rechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Weiterentwicklung in einzelnen Arealen. Damit deckt sie einen Teil des zusätzlichen Flächenbedarfs für öffentliche Nutzungen ab. Nicht Teil der Revision ist die mittel- bis langfristige Bereitstellung zusätzlicher Standorte für die öffentliche Infrastruktur.
Zwei Wege zu mehr Flächen
Zum einen wird an spezifischen Orten eine städtebaulich verträgliche Weiterentwicklung möglich. Konkret schafft die Revision in 25 ZöN Entwicklungspotenziale und dadurch auch Reserven für die Zukunft. Zum anderen wird die Möglichkeit eingeführt, die festgelegten Maximalhöhen unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Durchführung qualitätssicherndes Verfahren) um bis zu einem Drittel zu überschreiten (siehe dazu auch: Mehrhöhe). Dies erlaubt, bei einem konkreten Bauprojekt zusätzliche Potenziale zu prüfen. Bisher waren mehrjährige Planerlassverfahren nötig, um solche zusätzlichen Flächen zu schaffen.
Für viele Areale ändert die Revision wenig: Entweder sind die Ausbaupotenziale bereits ausgeschöpft, eine stärkere Nutzung kommt nicht infrage oder der Schutz des Grünraums oder des Ortsbildes hat Vorrang.
Profitieren Schulen und Sportanlagen?
Die Revision sichert die bestehenden Schulareale und Sportflächen. Die Schulareale sowie Sportflächen können dank den neuen Bestimmungen teilweise besser genutzt werden.
Mehr Raum für die Schulen
Mit den neu geschaffenen Potenzialen lässt sich ein Teil des benötigten zusätzlichen Schulraums decken. Laufende Ausbauprojekte von Schulanlagen sind in der Revision berücksichtigt, die Vorschriften werden bis zur öffentlichen Auflage bei Bedarf noch angepasst. Die weitergehende Sicherung von Flächen für Schulraum ist in separaten Verfahren mit Um- oder Einzonungen zu realisieren – das würde den Rahmen der ZöN-Revision sprengen.
Zusätzliche Sportflächen sind nicht Teil der Revision
Ein- oder Umzonungen zur Schaffung neuer Sportanlagen sind nicht Teil der Revision. Um ein Angebot bereitzustellen, das der wachsenden Nachfrage entspricht, hat die Stadt ihre Rasensportstrategie überarbeitet. Der Gemeinderat zeigt darin verschiedene Massnahmen auf, wie sich der Mangel entschärfen lässt (Optimierung der Belegung, Kunstrasen etc.). Weiter hat er Standorte für mögliche neue Rasensportflächen evaluiert. Drei Standorte – beim Bahnhof Brünnen Westside, bei der Endstation Tram 7 in Bümpliz und bei der Rudolf-Steiner-Schule im Melchenbühl – werden vertieft überprüft. Als Übergangslösung prüft die Stadt den Bau temporärer Sportplätze im Raum Saali.
Wie wird das Ortsbild gewahrt?
In städtebaulich sensiblen Gebieten müssen sich Neu-, Um- und Ergänzungsbauten gut in das Stadtbild einfügen, wofür qualitätssichernde Verfahren sorgen. Mit inventarisierten Schutzobjekten ist ebenso sorgfältig umzugehen. Das Bauinventar der Stadt Bern und die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit den Schutzobjekten gelten unabhängig von der ZöN-Revision. Bei Entwicklungsabsichten muss die Eigentümerschaft mit der Denkmalpflege die realistischen Entwicklungsmöglichkeiten ausloten.
Wie werden die Grün- und Freiräume geschützt?
Grün- und Freiräume sind in einer wachsenden und dichter werdenden Stadt besonders wichtig – für die Menschen, die Tiere und das Stadtklima. Alle bestehenden Grün- und Freiräume wie Parkanlagen, Plätze, Spielplätze, Friedhöfe, Stadtgärten werden deshalb mit der ZöN-Revision wirksamer geschützt als bisher. Bezüglich Überbaubarkeit gelten neu teilweise schärfere Regeln.
Mindestanteil vorgegeben
Konkret legt die ZöN-Revision einen Mindestanteil an Begrünung fest: in den meisten Arealen über eine Grünflächenziffer oder – bei mehreren Parzellen – über absolute anrechenbare Grünflächen, zum Teil ergänzt durch spezifische Vorgaben.
Bei Arealen, die bereits heute fast ganz überbaut oder versiegelt sind, verzichtet die Revision auf eine Grünflächenziffer, weil diese hier mit der Besitzstandgarantie kollidiert oder eine sinnvolle Nutzung verunmöglicht.
Urbane Freiräume sichern
Ein weiteres Instrument zum Schutz von Freiräumen: Einige unbebaute Flächen, die heute anderen Nutzungszonen zugewiesen sind, werden in ZöN überführt und so als zusätzliche öffentliche Freiräume gesichert – z. B. der Eigerpark. Heute gilt der Park als Verkehrsfläche, dient dem Quartier aber mit Bäumen, Bänken und Brunnen als wichtiger urbaner Freiraum.
Umgang mit Freiräumen in schützenswerten Ortsbildern
Wo Freiräume im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) geschützt sind, konkretisiert die Revision die Schutzbestimmung und begrenzt das Nutzungsmass. In gut begründeten Einzelfällen wird eine zusätzliche Bebauung einzelner Bereiche zulässig, z. B. im Bremgartenfriedhof.
Wie wird das Stadtklima verbessert?
Für das Stadtklima sind Grünräume zentral – mit der ZöN-Revision werden sie wirksamer geschützt. Grünflächen fördern die Schwammstadt. Versickert und verdunstet genügend Regenwasser, wirken sich Hitzetage, Tropennächte und Starkregen weniger stark aus. Auch dort, wo öffentliche Bauten und Anlagen baulich weiterentwickelt werden, fördert die Revision gestalterische Lösungen, die dem Stadtklima nützen.
Versickern, verdunsten, kühlen
Die Grünflächenziffer verhindert weitere, nicht zwingend nötige Versiegelungen und sorgt gleichzeitig dafür, dass ein möglichst grosser Teil der Freiräume und Aussenflächen entsiegelt wird. Zu diesem Zweck ist die vorgegebene Grünfläche (Grünflächenziffer) in mehreren Arealen grösser als der heutige Bestand. Mit der Grünflächenziffer werden zum Beispiel begrünte Aussenräume von Schulanlagen besser vor Überbauung oder Versiegelung geschützt.
Beschattung sichern und Regenabfluss begrenzen
In den urbanen Freiräumen schreibt die Revision vor, dass ein Teil der Flächen durch Schatten spendende Baumkronen abgedeckt ist. Vorgaben für Bodenbeläge sorgen dafür, dass nicht alles Regenwasser abfliesst – so bleibt das Wasser für die Bäume verfügbar und kühlt gleichzeitig durch Verdunstung die Luft.
Wird die Biodiversität gefördert?
Für die ZöN im Eigentum der Stadt Bern definiert das Biodiversitätskonzept 2025 spezifische Zielwerte für naturnahe Lebensräume. Deshalb muss die Stadt Bern bei einem eigenen Bauvorhaben aufzeigen, wie diese Zielwerte möglichst gut eingehalten werden können. Zudem gibt es die qualitative Vorgabe, einen möglichst grossen Anteil naturnaher Lebensräume und klimawirksamer Flächen zu realisieren.