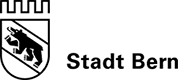Bern hindernisfrei
Die Stadt Bern hat sich zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er von allen Menschen autonom genutzt werden kann. Dies bedeutet, dass öffentliche Bauten und Anlagen sowie Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs so ausgestaltet werden, dass sie auch für ältere Menschen sowie für Menschen mit Behinderung ohne die Unterstützung weiterer Personen zugänglich sind. Auch Personen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck profitieren von einem hindernisfreien öffentlichen Raum.
Zur Umsetzung der Hindernisfreiheit im öffentlichen Raum hat die Stadt Bern in enger Zusammenarbeit mit den Alters- und Behindertenorganisationen das Konzept «Umsetzung hindernisfreier öffentlicher Raum» (UHR) erarbeitet. Dessen Basis ist das Eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) von 2004. Das BehiG verlangt, dass die Hindernisfreiheit bei allen Neu- und Umbauten im öffentlichen Raum gewährleistet wird. Im öffentlichen Verkehr müssen zudem bestehende Bauten an die Vorgaben des BehiG angepasst werden.
Für bestehende Anlagen des öffentlichen Raums ist die hindernisfreie Umgestaltung freiwillig. Die Stadt Bern hat sich aber zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Raum über die gesetzliche Pflicht hinaus grundsätzlich hindernisfrei umzugestalten. Sie will damit die Sicherheit für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum erhöhen und einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebensqualität leisten.
Die Stadt Bern setzt folgende Massnahmen zugunsten eines hindernisfreien öffentlichen Raums um.
ÖV-Haltestellen
Damit sie selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ist es für Menschen mit Behinderung wichtig, den öffentlichen Verkehr selbstständig nutzen zu können. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) legt fest, dass alle bestehenden ÖV-Haltestellen bis 2023 an die Vorgaben der Hindernisfreiheit angepasst werden müssen. Die Stadt Bern baut deshalb ihre Bus- und Tramhaltekanten so um, dass diese auch von Menschen mit Behinderung autonom genutzt werden können. Damit die ÖV-Fahrzeuge für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator ohne fremde Hilfe zugänglich sind, werden die Tram- und Bushaltestellen erhöht, sodass sie auf gleichem Niveau mit dem Einstiegsbereich der Fahrzeuge liegen. Dies zieht weitere bauliche Anpassungen an der Haltestelleninfrastruktur nach sich. Die Stadtberner Stimmbevölkerung hat dem Rahmenkredit am 4. März 2024 zugestimmt.
Sitzgelegenheiten
In Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen, dem Rat der Seniorinnen und Senioren und einem Designer hat die Stadt Bern ein neues alters- und behindertengerechtes Sitzbank-Modell entwickelt. Um älteren Menschen das Absitzen und Aufstehen zu erleichtern, verfügt die «Neue Berner Bank» über eine höhere Sitzfläche und eine steilere Rückenlehne als das bisherige Modell. Zudem ist die Bank so gestaltet, dass sie von Menschen mit einer Sehbehinderung ertastet werden kann. Für die ersten 500 neuen Bänke hat der Stadtrat 2019 einen Kredit von Fr. 3,7 Millionen Franken bewilligt. Diese wurden bis Anfang 2023 installiert.
Verkehrsraum
Zusätzlich zu den vom Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) geforderten Anpassungen an den ÖV-Haltestellen setzt die Stadt Bern freiwillig weitere Massnahmen um, die den Verkehrsraum sicherer und zugänglicher machen. So werden für Menschen mit Sehbehinderung taktil-visuelle Leitlinien angebracht, Fuss- und Velobereiche durch ertastbare Elemente voneinander abgetrennt und Abfallbehälter sowie temporäre Signale so gestaltet, dass sie ertastbar sind und nicht zum Verletzungsrisiko werden. Für Menschen mit Gehbehinderungen und für ältere Menschen sind niedrige Randsteine im Bereich von Strassenquerungen, das Vermeiden von Stufen sowie ausreichende Platzverhältnisse zum Manövrieren mit Rollstühlen oder Rollatoren Grundvoraussetzungen für die selbstständige Nutzung des Verkehrsraums. Für die Umsetzung der Massnahmen zur hindernisfreien Ausgestaltung des Verkehrsraums hat der Stadtrat einen Kredit von 3,6 Millionen Franken genehmigt. Die Realisierung erfolgt schrittweise seit 2023.
Lichtsignalanlagen
Die lichtsignalgesteuerten Verkehrsknoten in der Stadt Bern sollen an die Vorgaben der Hindernisfreiheit angepasst werden, damit insbesondere Menschen mit Sehbehinderung eine Strasse ohne Gefahr selbstständig überqueren können. Bei Lichtsignalanlagen, die nicht im Rahmen ordentlicher Erneuerungsprojekte angepasst werden können, werden die Anforderungsgeräte mit einer vibrierenden Platte ergänzt. Damit Menschen mit Sehbehinderung die Anlage erkennen, werden bei den Lichtsignalmasten taktil-visuelle Markierungen auf dem Boden angebracht. An besonders schwierig zu passierenden Verkehrsknoten werden weitere Massnahmen umgesetzt (z.B. die Ergänzung des vibrierenden Anforderungsgeräts mit einem akustischen Signal). Für die Anpassung der Lichtsignalanlagen hat der Stadtrat einen Kredit von 5,4 Millionen Franken gesprochen. Die schrittweise Realisierung erfolgt seit 2023.
Park- und Grünanlagen
Die Zugänglichkeit der öffentlichen Parkanlagen und der Friedhöfe in der Stadt Bern soll verbessert werden, da die oft vor vielen Jahren angelegten Anlagen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zahlreiche Hindernisse aufweisen. Die Massnahmen zur Beseitigung dieser Hindernisse betreffen vor allem die Beläge der Hauptwege (sie müssen fest und hart sein), die Installation von Orientierungselementen, den Bau von Rampen und die bessere Erkennbarkeit der Zugänge. Für alle Park- und Grünanlagen wurden in Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen Anforderungen an die Hindernisfreiheit definiert. Besonders stark frequentierte Anlagen haben zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Bei der hindernisfreien Ausgestaltung gilt es, stets auch der historischen Bedeutung der Anlage, deren Funktion, Topografie und dem zu erhaltenden Baum- und Pflanzenbestand Rechnung zu tragen. Für die Anpassung der Park- und Grünanlagen hat der Stadtrat einen Kredit von 2,5 Millionen Franken gesprochen. Die Arbeiten erfolgen seit 2023.
Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen
Wesentlich für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts UHR ist der regelmässige Austausch mit Behindertenorganisationen. Insbesondere mit der Arbeitsgruppe öffentlicher Raum (AGöR), der Procap, der Behindertenkonferenz Stadt und Region Bern (BRB), Alter Stadt Bern, der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Stadt Bern und dem Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV).
Richtlinien und Standards zur Umsetzung der Hindernisfreiheit
Mit dem Bericht UHR hat die Stadt Bern Standards für die Umsetzung eines hindernisfreien öffentlichen Raums erarbeitet. Die UHR-Standards wurden in die überarbeitete Version des «Handbuchs Planen und Bauen im öffentlichen Raum» aufgenommen und in die städtischen Normalien integriert.